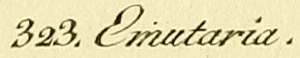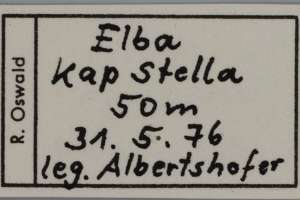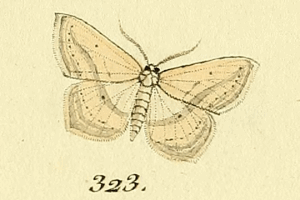+23Kontinente:EUAF
+23Kontinente:EUAF1. Lebendfotos
1.1. Falter
1.2. Raupe
1.3. Ei
2. Diagnose
2.1. Männchen
2.2. Weibchen
2.3. Genitalien
2.3.1. Weibchen
2.4. Erstbeschreibung
3. Biologie
3.1. Habitat
4. Weitere Informationen
4.1. Etymologie (Namenserklärung)
„emutatus verändert, wegen ihres abweichenden Aussehens im Vergleich zu den verwandten Arten.“
4.2. Andere Kombinationen
- Geometra emutaria Hübner, [1809] [Originalkombination]
4.3. Faunistik
Deutschland: Nach Kolligs & Drews (1999) kommt die Art wohl nur noch im Küstenbereich der Nordfriesischen Inseln Sylt und Amrum vor; die einzigen weiteren deutschen Vorkommen auf den Ostfriesischen Inseln seien wahrscheinlich erloschen. Am 25. Juni 2014 gelang Carsten Heinecke ein Falterfund auf Langeoog (siehe oben, Falterfoto), seine Nachsuche am 25 und 26. Juni 2014 erbrachte 14 Falter an derselben Stelle (Heinecke (2014: 210)); auch auf Borkum fand er 2014 einen Falter sowie auf Spiekeroog zwei – die Art ist also auf den Ostfriesischen Inseln noch rezent.
Wegner (2013) berichtet von historischen Funden (1937) auf der Ostfriesischen Insel Borkum und von rezenten Funden (zuletzt am 8. Juli 2011) an verschiedenen Stellen auf Sylt. Am 15. Mai 1996 fand er dort fünf Raupen an Kleinem Sauerampfer (Rumex acetosella) sowie zwei Raupen an Ferkelkraut (Hypochoeris radicata). Er argumentiert, dass die überwinternden Raupen als poikilotherme Tiere bei niedrigen Temperaturen kaum bewegungsfähig sind, so dass sie in den Salzwiesen bei den häufigen, oft mehrere Tage andauernden Überflutungen ertrinken würden, und führt deshalb anstelle des bisher üblichen deutschen Namens „Salzwiesen-Kleinspanner“ den Namen Küstendünen-Kleinspanner ein.
Ruckdeschel (2007: 7) strich die Art für die Fauna von Kreta: "Der bisher einzige Nachweis wurde von REISSER (1974b) publiziert. Es handelt sich um ein am 15.5.1971 von H. MALICKY in Protoria b. Pirgos (O-Kreta) gefangenes Männchen, das sich noch im SMNK befindet. Dieses erweist sich aber, wie bereits von HAUSMANN (2001) erkannt, als Scopula flaccidaria ZELLER."
(Autoren: Erwin Rennwald und Jürgen Rodeland)
4.4. Literatur
- Heinecke, C. (2014): Aktuelle Nachweise ausgewählter Schmetterlinge auf den Ostfriesischen Inseln (Lepidoptera). — Entomologische Zeitschrift 124 (4): 209-213. Schwanfeld.
- Erstbeschreibung: Hübner, J. [1790-1833]: Sammlung europäischer Schmetterlinge 5: pl. 1-113.
- Kolligs, D. & A. Drews (1999): Die Schmetterlinge in Schleswig-Holstein. Bunte „Sommervögel“ brauchen Hilfe. — Bauernblatt 53 (38): 16-17. [PDF auf umweltdaten.landsh.de]
- Ruckdeschel, W. (2007): Die Geometriden Kretas (Lepidoptera, Geometridae). — Nachrichtenblatt bayerischer Entomologen, 56 (1/2): 2-13.
- Wegner, H. (2013): Bestandssituation und Habitatpräferenz einiger Spannerfalter-Arten im nordwestdeutschen Tiefland (Lep., Geometridae). — Melanargia 25 (3): 109-158. [PDF auf ag-rh-w-lepidopterologen.de, ganzes Heft]