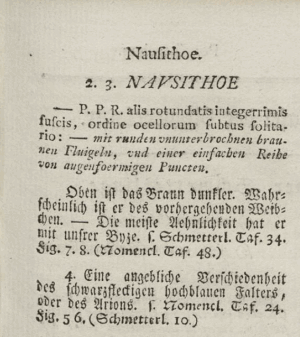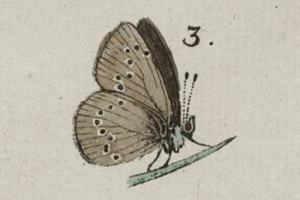+17Kontinente:EUAS
+17Kontinente:EUAS








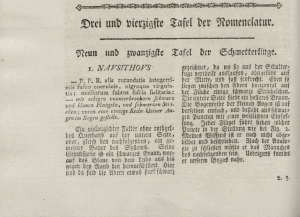



1. Lebendfotos
1.1. Männchen
1.2. Weibchen
1.3. Geschlecht nicht bestimmt
1.4. Aberration
1.5. Balz
1.6. Kopula
1.7. Eiablage
1.8. Ei
2. Diagnose
2.1. Weibchen
2.2. Erstbeschreibung
3. Biologie
3.1. Habitat
3.2. Prädatoren
3.3. Parasitoide
3.4. Nahrung der Raupe und Larvalbiologie
- [Rosaceae:] Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf)
Der Lebenszyklus der Art ist kompliziert, aber wenn man glaubt, ihn verstanden zu haben, beginnen erst die Schwierigkeiten ! Die Eiablage erfolgt in Blütenköpfchen des Großes Wiesenknopfs. Große terminale Köpfchen werden dabei klar bevorzugt. Die Eiablage erfolgt dort am häufigsten im Bereich der sich gerade öffnenden Einzelblüten des jeweiligen Köpfchens. die Raupe schlüpft - stark temperaturabhängig - nach ca. 8-10 Tagen und frisst danach - wieder temperaturabhängig - 2,5 bis 4 Wochen lang heranreifende Früchte in diesem Blütenköpfchen. Äußerlich ist von ihr in dieser Zeit nichts zu sehen. Danach verlässt sie im 4. Larvenstadium das jetzt fruchtende Blütenköpfchen und lässt sich am Boden von einer Ameise von Myrmica rubra adoptieren. Sie verbringt den Winter und den Frühling im Ameisennest und ernährt sich in dieser Zeit - vor allem im Frühjahr - dann von der Brut dieser Ameisen. Es muss also zur Flugzeit (im Kern von Mitte Juli bis Anfang August) ausreichende kräftige blühende oder erblühende Wiesenknopf-Köpfchen geben, die dann nach der Eiablage 5 Wochen lang nicht gemäht oder von Weidevieh abgefressen werden dürfen. Ein erster Mahdtermin oder Beweidungsdurchgang ist damit theoretisch im Mai oder Anfang Juni möglich. In einem regenfeuchten Jahr geht auch noch Mitte Juni, aber wenn es dann durchgehend trockenwarm wird, gibt es bis zur Flugzeit der Falter keine Wiesenknopf-Köpfchen zur Eiablage mehr. Es muss also bei diesem ersten Durchgang immer ein nennenswerter Teil stehen bleiben. Wird Anfang September gemäht, sind die Raupen in den meisten Jahren bereits am bzw. im Boden und von den Ameisen adoptiert. Da sich - besonders an heißen Tagen - aber auch dann der Nahrungsraum für die Ameisen dramatisch verändert, sollte wiederum ein nennenswerter Teil mit Ameisennestern stehen bleiben. Mehrjährige - aber nicht langjährige - Brachebereiche - oft entlang von Gräben oder auch Hecken - sind in den meisten Vorkommensbereichen von großer Bedeutung. Für das praktische Management der Falter-Kolonien beginnen die Schwierigkeiten jetzt erst: Die Ameisenkolonien müssen langjährig stabil gehalten werden und sich räumlich weitgehend mit den Orten der Eiablage der Falter decken. Siedeln die Ameisen nur in den Randbereichen einer Wiese und man lässt dort den Mittelstreifen der Wiese (mit mitunter besonders viel Wiesenknopf (!)) stehen, mäht die Randbereiche aber kurz oder während der Flugzeit der Falter, werden die Eier dort abgelegt, wo es gar nicht zur Adoption der Raupen kommen kann - gut gemeint, aber schlecht gemacht.
Schon Elmes et al. (1998: ) hatten darauf hingewiesen: "A common problem in the conservation of Maculinea is that most practitioners and advisers are lepidopterists or general ecologists, who have little experience of the biology of Myrmica (Elmes and Thomas, 1992). They frequently question wether Myrmica populations can be manipulated to aid the conservation of Maculinea. The answer is yes, but it is not easy. [...]". Das Dumme: Man muss jede Population einzeln betrachten, über die Verbreitung der Ameisen in der Fläche Bescheid wissen und Vieles mehr. Aber man kann ja auch aus Fehlern lernen: "Broadly speaking, there are three main reasons why a Maculinea population is small or starts to decline:
(i) Foodplants are widespread on a site but here are insufficient host ants throughout the site (either too few or too small colonies) to sustain the butterfly population. [...] detailed knowledge of the ants is still required." Wir müssen es kur Kenntnis nehmen: in Güllewiesen kann es massenhaft blühenden Wiesenknopf geben - aber keine Myrmica rubra.
(ii) There are sufficient host colonies but too few overlap with the foodplant population to sustain the butterfly population. Here there are two choices, either manipulate the whole environment to spread the ants into areas where plants are growing or spread the foodplants into the ant habitats." Dann werden die Schwierigkeiten im Detail aufgelistet - man braucht einen langen Atem.
(iii) There are sufficient host ant colonies overlapping with foodplants to sustain (theoretically) a butterfly population, but the food plant is so abundant that too many young caterpillars are, by chance, either recruited into secondary host ant nests or are never found by ants. This is quite a common situation for both M. nausithous and M. teleius whre the ant populations are concentrated towards the edges of hay meadows whereas the centres of fields which may contain low densities of Myrmica often support the highest densities of Sanguisorba. This situation is perhaps the easiest to remedy because there is no need to manipulate the ant population. Oviposition can be forced into the desired areas by selective cutting of the flowering stems of foodplants before the butterflies emerge and oviposit." - Doch Vorsicht: Auch hier müssen wir die Verteilung der Ameisenkolonien erst einmal genau studieren !
Und jetzt kommen weitere "Probleme" hinzu, von denen jene Autoren noch wenig ahnten: Klimaerwärmung führt zu veränderten Niederschlägen, führt öfters zu Überschwemmungen, aber noch öfters zur zeitweiligen Austrocknung der Böden, was für die Ameisen - ganz besonders nach einer Mahd - höchst problematisch ist. Doch auch die Falter benötigen schon unterhalb 30 °C möglichkeiten zur Schattenflucht - Obstbäume oder Hecken sind in den mitteleuropäischen Wärmegebieten mittlerweile nahezu obligatorisch für P. nausithous. Kleinräumig reichen mitunter auch Mähkanten aus, also ungemähte Streifen neben gemähten. Und diese Gehölze und sonstigen Strukturen sind nicht nur wichtig bei direkter Sonne, sondern auch bei den - ja ebenfalls zunehmenden - starken Winden zur Flugzeit. Windschutz war schon immer wichtig, wurde jetzt aber noch wichtiger.
Ameisenkenner sind zwar Hymenopterologen, aber über Schlupfwespen wissen sie in der Regel auch nicht mehr als Lepidopterologen ! Zum Verständnis der Bestandsentwicklung von Phengaris nausithous sollten sie aber wenigstens eine der vielen tausend Ichneumoniden-Arten kennen: Neotypus melanocephalus. Ebert & Rennwald (1991: 312) mussten noch vorsichtig vermelden: "In diesem Zusammenhang erwähnenswert scheint eine von G. Ebert und A. und S. Heitz unabhängig voneinander in der nördlichen bzw. mittleren Oberrheinebene angestellte Beobachtung zu sein: Eine Schlupfwespe fliegt die von M. nausithous besetzten von Sanguisorba officinalis an, in die hinein es offensichtlich ihre Eier legt (vgl. Abb.). Nach H. Hilpert handelt es sich dabei um Neotypus melanocephalus (Gmelin, 1790), "die häufigste Art der Gattung, die aber insgesamt recht selten ist." [...] Über die Biologie von Neotypus melanocephalus sei jedoch (jedenfalls bis 1981) noch nichts bekannt. Nach unseren Beobachtungen kommt als Wirt dieser Art der Bläuling Maculinea nausithous in Betracht. Ob der Parasit mit der Wirtslarve auch in das Ameisennest gelangt und in welchem Stadium das sein könnte, entzieht sich leider unserer Erkenntnis." Einmal darauf aufmerksam gemacht, konnte ich Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre am Mittleren und Nördlichen Oberrhein quasi in jeder größeren Phengaris nausithous-Population stets auch eine Anzahl dieser speziellen Schlupfwespe bei der Eiablage in Wiesenknopf-Köpfchen beobachten. Tatsächlich ist auch diese Art mittlerweile relativ gut studiert. Sie ist hochspezialisiert auf Raupen von Wiesenknopf-Ameisenbläulingen (zumindest in der Regel P. nausithous). Das Schöne: Diese Schlupfwespenart ist recht auffällig und auch für Laien relativ gut ansprechbar. Pfeifer (2016) zählte 2014 in einem Sommer jeden Tag Männchen und Weibchen der Phengaris-Bläulinge in einem 4,7 km langem Transekt in der Pfalz, dazu auch die Individuen der mit der Eiablage in Wiesenknopf-Köpfchen beschäftigten Ameisenbläulings-Schlupfwespe (Neotypus melanocephalus). Bei der täglichen Zählung zeigte sich, dass sich die Fluzeit von Bläuling und Schlupfwespe zwar stark überschnitten, dass der Schwerpunkt von Neotypus melanocephalus aber 2-3 Wochen nach demjenigen von Phengaris nausithous-Weibchen lag. Den eierlegenden Schlupfwespen standen also schon Jungraupen zur Verfügung, in die sie ihre Eier hineinlegen konnten. Wie auch andere Schlupfwespen ist das Wachstum der eigenen Larven ganz an das Wachstum der Bläulingsraupe angepasst. Erst nach der Verpuppumg der Raupe werden lebenswichtige Organe angegriffen, die junge Puppe also abgetötet und die Schlupfwespenlarve verpuppt sich im Rest der Schmetterlingspuppe. Statt eines Bläulings schlüpft eben eine Schlupfwespe. Der Besatz kann 70-80 % aller Raupen einer Population machen, hat also Einfluss auf die Anzahlen der Falter.
Anton et al. (2007a, 2007b) widmeten sich auch der Fortpflanzungsstrategie und der Genetik dieser Schlupfwespe - und machten sich auch Gedanken um deren Schutz. Denn diese Schlupfwespe verschwindet schon vor ihren Wirtsbläulingen, ist also noch stärker gefährdet als sie. Jene Autoren, aber auch Sorg et al. (2008) und Pape et al. (2016) sind sich einig, dass diese Schlupfwespe nicht eine zentrale Gefahr für P. nausithous ist, sondern ein sehr guter Indikator für langjährig stabile Populationen des Bläulings. Der Parasitoid verhindert noch wesentlich höhere Falterdichten, die dann über ihre Raupen zum Zusammenbruch der Ameisenkolonien führen könnten. Und tatsächlich: Am nördlichen Oberrhein sind nach meinen Beobachtungen als Erstes die Ameisenbläulings-Schlupfwespen komplett weggefallen. Doch die schwachen Falter-Populationen erholten sich auch ohne Parasitoiden nicht im Geringsten - der Zusammenbruch hatte also ganz andere Ursachen. Man muss es so sehen: Phengaris nausithous-Populationen mit noch nennenswertem Besatz von Neotypus melanocephalus sind die einzigen mit noch nennenswerten Aussichten auf ein längerfristiges Überleben.
Leider muss man sich als Spezialist für Phengaris-Arten aber noch immer mit dem zentralen Problem der Einhaltung von Mahdterminen herumschlagen (z.B. Koch 2018), selbst in ausgewiesenen Schutzgebieten für diese Arten. Das wurde schon von Ebert & Rennwald (1991) beanstandet und hat sich bis heute nicht geändert. Auch der Faktor Lebensraumzerstörung durch Baumaßnahmen ist so aktuell wie vor Jahrzehnten; nicht selten sind es dabei gar nicht die direkten Eingriffe, sondern gerade die "Ausgleichsmaßnahmen", die die letzten Restvorkommen der Art vernichten.
(Autor: Erwin Rennwald)
4. Weitere Informationen
4.1. Etymologie (Namenserklärung)
arcas: „ein Sohn des Poseidon.“
4.2. Andere Kombinationen
- Papilio nausithous Bergsträsser, [1779] [Originalkombination]
- Maculinea nausithous (Bergsträsser, 1779) [bis zur Entscheidung der International Commission on Zoological Nomenclature 2017 (Opinion 2399) übliche Kombination]
- Glaucopsyche nausithous (Bergsträsser, 1779)
4.3. Synonyme
- Papilio arcas Rottemburg, 1775
- Papilio nausithoe Bergsträsser, [1779]
- Maculinea erebus (Knoch, 1782)
- Lycaena kijevensis Sheljuzhko, 1928
4.4. Taxonomie und Nomenklatur
Loritz (2007) warnte uns vor: „Nachdem Maculinea zeitweise als Untergattung innerhalb der Gattung Glaucopsyche geführt wurde (Hesselbarth et al. 1995, Nässig 1995, Settele et al. 2000), zeigen neuere genetische Untersuchungen, dass Maculinea nur mit der zentral- bis ostasiatisch verbreitenden Gattung Phengaris sehr nahe verwandt ist (Als et al. 2004). Möglicherweise werden in Zukunft beide Gattungen unter dem erstbeschriebenen Namen Phengaris synonymisiert. Eine solche Gattung Phengaris wäre innerhalb des Tribus der Polyommatini monophyletisch.“ Der formale Schritt wurde dann von Fric et al. (2007) vollzogen. In die deutschsprachige Literatur hatte das bisher noch keinen Eingang gefunden. Das änderte sich schlagartig mit dem Erscheinen der 2. Auflage von „Schmetterlinge. Die Tagfalter Deutschlands“ (Settele et al. 2009) Ende Februar 2009. Dort verrät nur ein winziger Kommentar bei “ Phengaris rebeli”, warum man den Namenswechsel in der Gattung vollzog: “Neue Erkenntnisse veranlassten uns, die Zuordnung des alten Gattungsnamens Maculinea als Untergattung zu Phengaris zu übernehmen (vgl. Fric et al. 2007)."
Brower (2008) erläutert: “Phylogenetic relationships as inferred from combined molecular and morphological evidence by Fric et al. (2007). Note that the former genus Maculinea, which included the European species M. arion and M. rebeli (now viewed as a synonym/subspecies of P. alcon), represents both basal and derived members of Phengaris. The type species of Maculinea is P. alcon, so even if Maculinea were retained as a distinct genus, it would not contain the charismatic European species P. arion.” Tatsächlich zeigt sein – wohl unverändert aus Fric et al. (2007) übernommenes – Kladogramm der verwandtschaftlichen Verhältnisse, dass alcon – also die Art, anhand derer die Gattung Maculinea beschrieben wurde – die Schwestergruppe zu allen anderen 10 Arten der bisherigen Gattungen Maculinea und Phengaris ist. Wenn dem so wäre gäbe es zwei denkbare Lösungen:
Entweder es gibt nur eine Gattung: dann müsste sie – weil klar prioritätsberechtigt – Phengaris heißen, oder aber Maculinea und Phengaris werden als getrennte Gattungen akzeptiert: dann würden nur alcon (und rebeli) zu Maculinea gehören, alle anderen Arten zu Phengaris. Im Falle von Phengaris als einziger Gattung stünde Maculinea nur noch in Kombination mit alcon (und rebeli) als Untergattung zur Verfügung, nicht aber für nausithous, teleius oder arion. Wir müssen uns also schon mal bereit machen, umzulernen, aber ich möchte das nicht überstürzen.
Mein Problem: Im Kladogramm, das BROWER (2008) zeigt, werden alle Äste als schwarze Striche durchgezogen, d.h. es wird nicht differenziert zwischen statistisch hochsignifikant abgesicherten und nur ganz vagen Verwandtschaftsverhältnissen. Man kann es glauben oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob das im Original anders ist – ich hoffe es. Und dann mag ich Kladogramme überhaupt nicht. Gegenüber Phylogrammen, die auf den exakt gleichen Daten basieren, haben sie zwei Vorteile: Da alle Verästelungen rechtsbündig sind, lassen sie sich zum einen leicht beschriften, zum anderen sind sie prächtig geeignet, alles, was den Baum in Frage stellen könnte, zu vertuschen. Wahrscheinlich sind es beide Gründe, warum man bei Verwandtschaftsstudien auf genetischer Basis fast nur Kladogramm und eben keine Phylogramme findet. Ich möchte jetzt erst einmal wissen, wie viele Gene und welche hier für den Baum genutzt wurden – und natürlich auch, ob es beim Zugrundelegen verschiedener Gene zu verschiedenen Bäumen gekommen ist, von denen aber nur der angenehmste gezeigt wurde. [Hier haben wir in den letzten Jahren zunehmend das Problem, dass bei der Untersuchung von mehr Genen es in vielen Fällen zu konkurrierenden Bäumen kommt, die aber beide als statistisch hochgradig abgesichert gelten … ]. Mal sehen, wie das weitergeht.
Ergänzung 5. Mai 2017: Die Zeit vergeht und die Kommission rührt sich nicht ... Aarvik et al. (2017) schließen daraus: "Fric et al. (2007) introduced Phengaris Doherty (1891) as the senior synonym of the genus that in Europe has been known as Maculinea Van Eecke, 1915. An application was sent to ICZN (Balletto et al. 2010) to conserve Maculinea. After six years ICZN still has not made a decision. In the meantime Phengaris has become more accepted, and we think it is unlikely that ICZN will vote in favour of the application. For this reason we follow simple priority in the present list." Ich fürchte, dass die Autoren Recht behalten werden und wir uns an den Namen Phengaris gewöhnen müssen - noch warte ich hier aber auf eine Entscheidung der Kommission (wozu haben wir die eigentlich?) und bleibe bei Maculinea.
Ergänzung 30. Oktober 2017:
Es kam, wie es zu befürchten war ...
Im Juni 2010 wurde von der Antrag auf Konservierung des Gattungsnamens Maculinea gestellt: "The purpose of this application, under Article 23.9.3 of the Code, is to conserve the widely used generic name Maculinea Van Eecke, 1915 in its accustomed usage. The name Maculinea Van Eecke, 1915 is threatened by its senior synonym Phengaris Doherty, 1891. It is proposed that Maculinea be given precedence over the other name whenever the two are considered to be synonyms." Und weil es kaum einen klassischeren Fall als hier gibt, wegen dem Artikel 23.9.3 überhaupt ins Leben gerufen wurde (immerhin ist Maculinea weit über wissenschaftliche Kreise hinaus zum Begriff geworden!), wäre eine rasche positive Entscheidung der Kommission eigentlich zu erwarten gewesen. Eigentlich ... Doch es zögerte sich alles über viele Jahre hinaus. Ich denke, die Diskussionskultur läuft hier grundsätzlich schief: Zugang zu den Artikel-Details auf bioone.org hat nur, wer entweder Teil eines registrierten Instituts ist, oder eben selber genug Geld hinlegt. Die "Praktiker" werden hier grundsätzlich nicht gefragt. Immerhin: Es gab diverse Diskussionsbeiträge und dabei zeichnete sich schon ab, was zu erwarten war. Doch nicht einmal die Entscheidungen der (geheim zusammengesetzten, sich selbst erwählenden) Kommission sind öffentlich frei zugänglich - freie Wissenschaft stelle ich mir da anders vor.
Im August 2017 wurde von dieser International Commission on Zoological Nomenclature das Ergebnis verkündet (Opinion 2399): "The International Commission on Zoological Nomenclature has declined to use its plenary power to conserve the generic name Maculinea Van Eecke, 1915 in its accustomed usage. As a result the generic name Phengaris Doherty, 1891 has priority over Maculinea Van Eecke, 1915 whenever the two are considered to be synonyms." Basta!
Und jetzt? Müssen wir dieser anonymen Altherrenrunde folgen? Rechtlich gesehen sicher nicht. Aber im Sinne der nomenklatorischen Stabilität eben doch. Also stelle ich hier jetzt doch auf Phengaris um - auch wenn Maculinea in der Praxis sicher noch lange Bestand haben wird.
(Autor: Erwin Rennwald)
4.5. Literatur
- Aarvik, L., Bengtsson, B.Å., Elven, H., Ivinskis, P., Jürivete, U., Karsholt, O., Mutanen, M. & N. Savenkov (2017): Nordic-Baltic Checklist of Lepidoptera. — Norwegian Journal of Entomology - Supplement No. 3: 1-236. [PDF auf entomologi.no]
- Als, T. D., Vila, R., Kandul, N. P., Nash, D. R., Yen, S.-H., Hsu, Y.-F., Mignault, A. A., Boomsma, J. J. & N. E. Pierce (2004): The evolution of alternative parasitic life histories in large blue butterflies. — Nature 432: 386-390. London.
- Anton, C., Musche, M. & J. Settele (2007): Spatial patterns of host exploitation in a larval parasitoid of the predatory dusky large blue Maculinea nausithous. — Basic and Applied Ecology, 8 (1): 66-74. https://doi.org/10.1016/j.baae.2006.03.006. [Sekundärzitat nach dem ausführlichen Abstract auf [sciencedirect.com]]
- Anton, C., Zeisset, I., Musche, M., Durka, W. Boomsma, J.J. & J. Settele (2007): Population structure of a large blue butterfly and its specialist parasitoid in a fragmented landscape. — Molecular Ecology, 16: 3828–3838. DOI: 10.1111/j.1365-294X.2007.03441.x. [PDF auf ufz.de]
- Balletto, E., Bonelli, S., Settele, J., Thomas, J.A., Verovnik, R. & N. Wahlberg (2010): Case 3508. Maculinea Van Eecke, 1915 (Lepidoptera: lycaenidae): proposed precedence over Phengaris Doherty, 1891. — The Bulletin of Zoological Nomenclature 67(2): 129-132. [https://doi.org/10.21805/bzn.v67i2.a3] [zum Abstract und zum Kauf des Vollartikels auf bioone.org]
- Erstbeschreibung: Bergsträsser, J. A. (1779): Nomenclatur und Beschreibung der Insecten in der Graffschaft Hanau-Münzenberg wie auch der Wetterau und der angränzenden Nachbarschaft dies und jenseits des Mains mit erleuchteten Kupfern. Zweiter Jahrgang. 1-80, pl. 1-48. Hanau (im Verlage des Verfassers).
- Brower, A. V. Z. (2008): Phengaris Doherty 1891. Maculinea van Eecke 1915 currently viewed as a subjective junior synonym. Version 06 January 2008 (under construction). [http://tolweb.org/Phengaris/112250/2008.01.06] in The Tree of Life Web Project, [http://tolweb.org/]
- Ebert & Rennwald (1991b) (= Ebert 2), 307-314.
- Elmes, G.W., Thomas, J.A., Wardlaw, J.C., & D.J. Simcox (1998): The ecology of Myrmica ants in relation to the conservation of Maculinea butterflies. — Journal of Insect Conservation 2(1):67-78. DOI: 10.1023/A:1009696823965. [zum PDF-Download auf researchgate.net]
- Fric, Z., Wahlberg, N., Pech, P. & J. Zrzavý, J. (2007): Phylogeny and classification of the Phengaris-Maculinea clade (Lepidoptera: Lycaenidae): total evidence and phylogenetic species concepts. — Systematic Entomology 32 (3): 558-567. [PDF auf baloun.entu.cas.cz] bzw. [Abstract auf onlinelibrary.wiley.com]
- International Commission on Zoological Nomenclature (2017): Opinion 2399 (Case 3508) — Maculinea Van Eecke, 1915 (Lepidoptera: Lycaenidae): precedence over Phengaris Doherty, 1891 not granted. — The Bulletin of Zoological Nomenclature 74(): 117-119. [https://doi.org/10.21805/bzn.v74.a029] [zum Abstract und zum Kauf des Vollartikels auf bioone.org]
- Koch, M. (1018): Untersuchungen zur Raumverteilung bei Eiablagen von Maculinea nausithous (Bergsträsser, 1779) und M. teleius (Bergsträsser, 1779) in unterschiedlich strukturierten Wiesenhabitaten mit syntopen Vorkommen beider Arten. — Masterarbeit im Studium Naturschutz und Landschaftspflege, Hochschule Anhalt (FH) Fachbereich Landwirtschaft, Ökotrophologie und Landschaftsentwicklung. [PDF auf opendata.uni-halle.de]
- Loritz, H. (2007): Ameisenbläulinge (Gattung Maculinea). Übersicht zu Biologie, Ökologie und Parasitoiden. — S. 309-312. In: Schulte, T., Eller, O., Niehuis, M. & E. Rennwald (2007): Die Tagfalter der Pfalz. — 2 Bde. 932 S. Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft 36 + 37.; Landau (GNOR-Eigenverlag).
- Nässig, W. A. (1995): Die Tagfalter der Bundesrepublik Deutschland: Vorschlag für ein modernes, phylogenetisch orientiertes Artenverzeichnis (kommentierte Checkliste) (Lepidoptera, Rhopalocera). — Entomologische Nachrichten und Berichte 39: 1-28. Leipzig.
- Pape, F., Zieger, S., Neißkenwirth genannt Schroeder, S., B. Bartsch & D. Singer (2025): Die Ameisenbläulings-Schlupfwespe Neotypus melanocephalus (Gmelin, 1790) in Niedersachsen – Einblick in die Verbreitung des spezifischen Parasitoiden der FFH-Art Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling Phengaris nausithous (Bergsträsser, 1779). — Artenfocus Niedersachsen, 2: 6-22. [zum PDF-Download auf researchgate.net]
- Pfeifer, M.A. (2016): Phänologie von Neotypus melanocephalus (Gmelin, 1790) (Hymenoptera: Ichneumonidae), eines Parasitoiden der Wiesenknopf-Ameisenbläulinge Phengaris nausithous (Bergsträsser, 1779) et Phengaris teleius (Bergsträsser, 1779) (Lepidoptera: Lycaenidae). — Entomologische Zeitschrift, 126 (2): 81-85.
- Reifenberg, T. C. (2024): Auf der Suche nach den Wiesenknopf-Ameisenbläulingen in der Ortsgemeinde Oberelbert im Westerwald (Lep., Lycaenidae). — Melanargia 36 (3/4): 96-98.
- Schweizerischer Bund für Naturschutz [Hrsg.] (1987): Tagfalter und ihre Lebensräume. Arten – Gefährdung – Schutz. — XI + 516 S. (hier 361-363), Egg/ZH (Fotorotar AG).
- Settele, J., Steiner, R., Reinhardt, R. & R. Feldmann (2005): Schmetterlinge. Die Tagfalter Deutschlands. — 256 S.; Stuttgart (Ulmer-Verlag).
- Settele, J., Steiner, R., Reinhardt, R., Feldmann, R. & G. Hermann (2009): Schmetterlinge. Die Tagfalter Deutschlands. 2. aktualisierte Auflage. — 256 S.; Stuttgart (Ulmer-Verlag).
- Śliwińska, E. B., Nowicki, P., Nash, D. R., Witek, M., Settele, J. & M. Woyciechowski (2006): Morphology of caterpillars and pupae of European Maculinea species (Lepidoptera: Lycaenidae) with an identification guide. — Entomologica Fennica 17 (4): 351-358. [PDF auf journal.fi]
- Sorg, M., Schwan, H. & W. Stenmans (2008): Die Schlupfwespe Neotypus melanocephalus (Gmelin, 1790) in Nordrhein-Westfalen und das Monitoring der Ameisenbläulinge (Phengaris spp.). — Mitteilungen aus dem Entomologischen Verein Krefeld, 1: 1-5. [PDF auf d-nb.info]